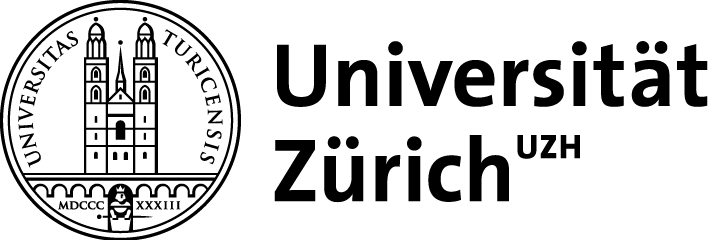Als traditioneller Übergang vom Tag zur Nacht stellte die Vesper einen wichtigen Wendepunkt im städtischen Tagesgeschehen dar. Die Vesperglocke markierte das Ende des Werktages und damit den Feierabend. Das Zürcher Sechseläuten erinnert entfernt noch an die hohe Bedeutung der Vesper. Gleichzeitig zeigt es die Verquickung von Klangereignis, liturgischer Stunde und Ordnung, die weitreichende Bedeutung von Klang und Musik im städtischen Leben.
Der wissenschaftliche Themenvormittag widmet sich deshalb der Stadt als Ort kondensierter Lebensräume, in dem unterschiedliche Gruppen aufeinandertreffen und ihre Interessen vertreten: Händler und Handwerker hatten andere Beweggründe, in Städten zu wirken, als die Kleriker oder die städtische Oberschicht (ganz zu schweigen vom Gesinde und von den marginalisierten Bevölkerungsteilen). Wer an der Stadtöffentlichkeit teilnehmen durfte und wer nicht, war dabei ein Aushandlungsprozess, der auch performativ z.B. durch Prozessionen von Geistlichen oder Handwerkern durchgesetzt wurde. Die Akteure gestalteten ihre Stadt nicht allein politisch, sondern auch kulturell und nicht zuletzt musikalisch.
Die Stadt, ihre «Soundscape» und ihre musikalische Raumkultur sind aktuelle Gegenstände der musikwissenschaftlichen Forschung. Ziel dieser Beschäftigung ist es, nicht nur die musikalischen Werke selbst zu betrachten, sondern sie als Teil sozialen Handelns zu begreifen: Wie wirkten die einzelnen Räume (Kirchenraum, Plätze etc.) auf die Aufführung? Wie die Zeiten (Tages-, Jahreszeit)? Und wie reagierte die Stadtgesellschaft auf die öffentliche Darbietung von Musik?
Der wissenschaftliche Themenvormittag widmet sich daher der Stadt als klingendem Phänomen – mit besonderem Schwerpunkt auf Italien und der Schweiz in der frühen Neuzeit. Die Beiträge bieten deshalb ein breites interdisziplinäres Spektrum an: von der theologischen Konzeptualisierung der Stadt als Klangraum in schweizerischen Kontexten über die Klangräume der Nacht bis hin zur klanglichen Gestaltung der Stadt am Beispiel italienischer Städte.